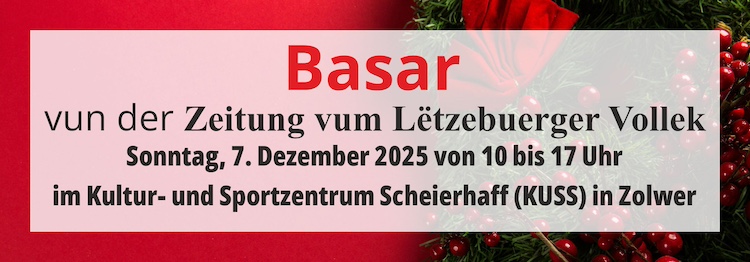Streit um größtes Stück vom Rüstungskuchen
Steigt die französische Dassault Aviation auch aus dem Megaprojekt FCAS mit Deutschland und Spanien aus?
Es geht um Hunderte Milliarden Euro, die Technologieführerschaft in einem strategisch wichtigen Bereich, um Einfluß, Prestige und nicht zuletzt um kollektivvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze in der EU-weit kriselnden Industrie: Zwischen Frankreich und Deutschland herrscht ein handfester Streit um das »Luftkampfsystem der Zukunft«, das »Future Combat Air System« (FCAS), das seit 2018 mit spanischer Beteiligung entwickelt wird. Als Beobachter ist zudem Belgien seit zwei Jahren dabei, obwohl die Regierung US-amerikanische Kampfjets vom Typ »F-35« für die belgischen Luftstreitkräfte kaufen will – und nicht die französische »Rafale« oder den »Eurofighter«, der in Deutschland und Spanien produziert wird. Allein für ihre Beobachterrolle hat die belgische Regierung 300 Millionen Euro bezahlt.
Bis 2040 soll das FCAS offiziellen Angaben aus Berlin und Paris zufolge einsatzbereit sein. Es verfügt demnach dank des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) über autonome Fähigkeiten und besteht aus drei Komponenten: dem eigentlichen hochmodernen und atomwaffenfähigen Kampfjet der »sechsten Generation«, ständig mitfliegenden Aufklärungs- und Kampfdrohnen sowie einer »Gefechtswolke«, in der weitere Heeres- und Marineverbände miteinander vernetzt werden können. Anfangs hieß es, die Entwicklung des FCAS – vom Kampfjet wurde bis heute noch kein Prototyp gebaut – werde ungefähr 100 Milliarden Euro kosten, doch muß einer Ende 2023 veröffentlichten Greenpeace-Studie zufolge mit Kosten von insgesamt 1,1 bis zwei Billionen (man kann auch sagen: 1.100 bis 2.000 Milliarden) Euro gerechnet werden.
Auf dem Pariser Aérosalon im Juni hatte der Vorstandsvorsitzende der französischen Dassault Aviation, Éric Trappier, die Drittelung zwischen seinem Unternehmen, der deutsch dominierten Airbus Defense und der spanischen Indra Sistemas öffentlich in Frage gestellt und eine eindeutige Projektführerschaft gefordert. Schon vor dem zuständigen Ausschuß der Nationalversammlung hatte sich der Dassault-Chef im April skeptisch gezeigt, daß das beim FCAS mit einer ständigen Drittelung der Aufträge gelingen könne. »Ich bin für eine globale Projektleitung«, erklärte Trappier ohne Umschweife. Weil das gesamte Kampfsystem »um ein Flugzeug und Drohnen herum gedacht« werde, komme es auf die technischen Schnittstellen an. »Und wenn es keinen echten über allen stehenden Leader gibt, funktioniert das nicht mit den Schnittstellen.«
Bei der Einschätzung des Gesagten muß bedacht werden, daß Dassault Aviation, der Konzern, der die französischen Kampfjets »Mirage« und »Rafale« baut, in den 80er Jahren schon mal aus der Entwicklung des »Eurofighter« mit Airbus, der britischen BAE Systems und dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo ausgestiegen ist. Wie Trappier den Deputierten versicherte, traut sich seine Rüstungsschmiede die komplett eigenständige Entwicklung der neuen Kampfflugzeuge mit französischen Partnern ebenfalls zu.
Und nachdem es in »Industriekreisen« geheißen hatte, die Franzosen pochten auf den Löwenanteil des Projekts – die Rede ist von einer Erhöhung des französischen Drittels auf 80 Prozent (!) – war beim Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie von einem »einseitigen französischen Dominanzstreben« die Rede.