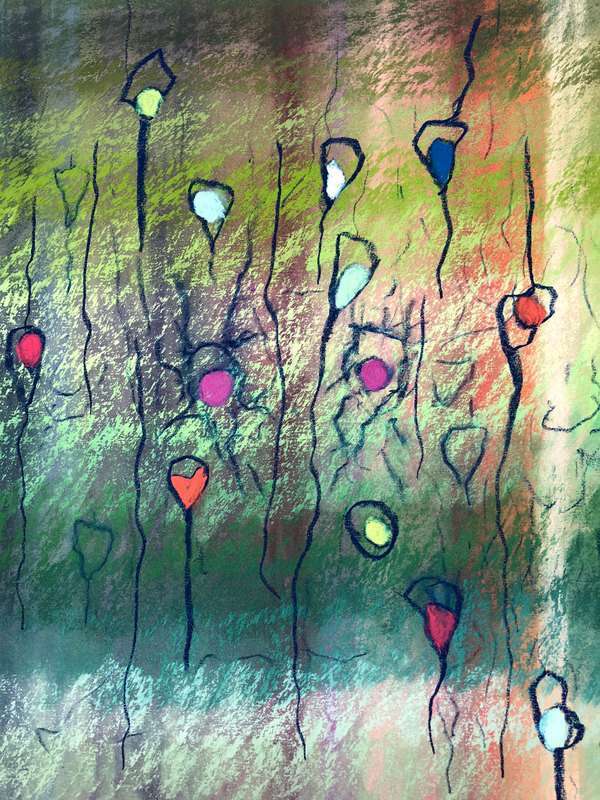Gehirnatlas: Mensch hat über 3.000 Hirnzelltypen
Mehrere Forscherteams haben zusammen den bislang umfangreichsten Zellatlas des menschlichen Gehirns erstellt und unter anderem mehr als 3.000 verschiedene Typen von Hirnzellen ermittelt. Sie hatten beispielsweise untersucht, wie Nervenzellen im Gehirn in ihren Funktionen voneinander abweichen. Insgesamt 21 Studien, die Teil der «Brain Initiative» der Gesundheitsbehörde der USA (NIH) sind, werden in den Fachjournalen »Science«, »Science Advances« und »Science Translational Medicine« präsentiert.
Ein Team um Kimberly Siletti vom Karolinska Institut in Stockholm untersuchte Gewebe aus 14 menschlichen Gehirnen. Es klärte mit einer neuen Methode auf, welche RNA-Folgen in den einzelnen Hirnzellen vorhanden waren. RNA (Ribonukleinsäure) dient unter anderem als Überträger der Information aus dem Erbgut, um Proteine herzustellen. Je nach den Aufgaben von Zellen unterscheiden sich die RNA-Sequenzen in ihnen, woraus die Forscher 3.313 verschiedene Typen von Zellen ableiten konnten. Der Datensatz für diese Arbeit umfaßte mehr als drei Millionen Gehirnzellen.
In zwei weiteren Studien untersuchten ein Team um Yang Li von der University of California und eines um Wei Tian vom Salk Institute for Biological Studies die Epigenetik einzelner Gehirnzellen. Epigenetische Mechanismen bestimmen, wie oft welches Gen in einer Zelle aus dem Erbgut abgerufen wird. Die Epigenetik wird auch von der Umwelt, von Ernährung und Alterung beeinflußt. Aus diesen drei Studien zusammengenommen, ist ein Hirnzellenatlas entstanden, der einzelne Hirnzelltypen charakterisiert und sie einzelnen Gehirnregionen zuordnet. Dieser Atlas ist für alle Wissenschaftler frei zugänglich.
»Dies ist wirklich der Beginn einer neuen Ära in der Hirnforschung, in der wir besser verstehen können, wie sich Gehirne entwickeln, wie sie altern und von Krankheiten in Mitleidenschaft gezogen werden«, sagte Joseph Ecker vom Salk Institute, der an mehreren der Studien beteiligt war.
Die Aktivitäten für den Hirnzellatlas sind im Projekt BICCN (Brain Initiative Cell Census Network) gebündelt. BICCN erlaubt nun auch, weitere Erkenntnisse über das menschliche Gehirn zu gewinnen, zum Beispiel darüber, wie sich die Gehirne von Menschen und Affen unterscheiden. Das hat unter anderem ein Team um Nikolas Jorstad vom Allen Institute for Brain Science in Seattle getan: Es untersuchte Proben einer Hirnregion, die beim Menschen mit der Gesichtserkennung und mit dem Lesen in Verbindung gebracht wird, von erwachsenen Menschen, Schimpansen, Gorillas, Rhesusaffen und Weißbüschelaffen.
»Nur wenige Hundert Gene zeigten menschenspezifische Muster, was darauf hindeutet, daß relativ wenige zelluläre und molekulare Veränderungen die Hirnrindenstruktur des erwachsenen Menschen eindeutig definieren«, fassen Jorstad und Kollegen ihre Erkenntnisse zusammen.
Doch es geht den Forschern auch um Fortschritte in der Humanmedizin: »Die Kartierung der verschiedenen Zelltypen im Gehirn und das Verständnis ihrer Zusammenarbeit werden uns letztendlich dabei helfen, neue Therapien zu entdecken, die auf einzelne Zelltypen abzielen, die für bestimmte Krankheiten relevant sind«, sagt Bing Ren von der University of California. Ren ist der Seniorautor der Studie von Li und Kollegen. Die Wissenschaftler konnten molekularbiologische Aspekte von 107 verschiedenen Subtypen von Gehirnzellen mit einem breiten Spektrum neuropsychiatrischer Erkrankungen in Verbindung bringen, darunter waren Schizophrenie, bipolare Störung, Alzheimer-Krankheit und schwere Depression.
Weitere Forschungsarbeiten betrafen die Entwicklung des menschlichen Gehirns ab dem frühen Embryonalstadium. Diese Forschung brachte dem Team von Sten Linnarsson vom Karolinska Institut auch neue Erkenntnisse über das Glioblastom, einen der aggressivsten Hirntumoren. Demnach ähneln die Tumorzellen unreifen Stammzellen, die versuchen, ein Gehirn zu bilden, allerdings auf unorganisierte Weise. »Wir beobachteten, daß diese Krebszellen Hunderte von Genen aktivierten, die für sie spezifisch sind, und es könnte interessant sein zu untersuchen, ob es ein Potential für die Suche nach neuen therapeutischen Zielen gibt«, erklärte Linnarsson.